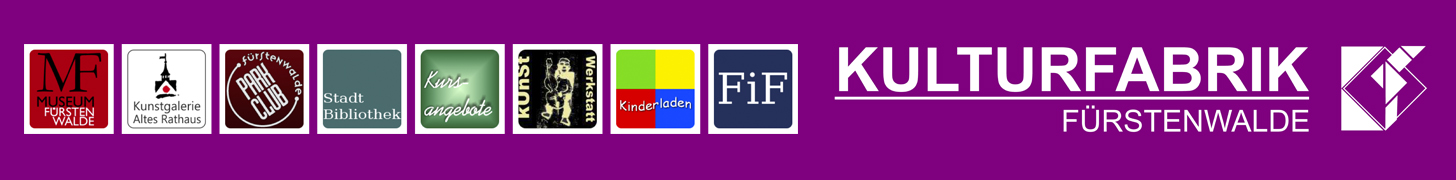Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie beweist, dass Prävention wirkt
Seit 35 Jahren wird die Zahngesundheit der Bevölkerung in regelmäßigen Abständen untersucht. Nunmehr konnte die Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie durch das Institut derDeutschen Zahnärzte, die Bundeszahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das klare Ergebnis der Studie: Prävention wirkt.
Die Mundgesundheitsstudie belegt den Erfolg der präventionsorientierten Zahnmedizin bei der Bekämpfung von Karies. Zurückzuführen ist das auf die breite Inanspruchnahme umfangreicher Präventionsleistungen, beginnend bei den Früherkennungsuntersuchungen für Kleinkinder über die Gruppenprophylaxe bis hin zur Individualprophylaxe, verbunden mit regelmäßigen Kontrollen.
In der Gruppe der 12-Jährigen, so das Ergebnis der Untersuchung, sind 78 Prozent kariesfrei. Bei den jüngeren Erwachsenen (35 bis 44-Jährige) hat sich die Karieserfahrung seit 1989 halbiert. Die Anzahl fehlender Zähne ist gleichzeitig signifikant zurückgegangen, was bedeutet, das viele Menschen bis zur Mitte ihres Lebens keinen einzigen Zahn verloren haben. Ein ähnlich positives Bild vermittelt die Gruppe der jüngeren Senioren (65 bis 74-Jährige). Immer weniger Menschen sind in diesem Alter vollständig zahnlos und die Anzahl funktionstüchtiger Zähne ist dank zahnerhaltender Therapien deutlich gestiegen.
Sorgen bereitet hingegen die steigende Zahl von Parodontalerkrankungen. Etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Angesichts der wissenschaftlichen Hinweise, das Parodontitis Einfluss auf Herz-Kreislauferkrankungen haben und die Allgemeingesundheit gefährden könnte, ein alarmierendes Zeichen.
Weiterhin belegen die Ergebnisse eine hohe Prävalenz von Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation, umgangssprachlich auch als „Kreidezähne“ bezeichnet. Diese Erkrankung, deren Ursachen noch nicht abschließend geklärt sind, kann nicht durch individuelles Verhalten, wie Mundhygiene und regelmäßiges Zähneputzen beeinflusst werden. Als entwicklungsbedingte Störung entsteht sie bereits vor der Geburt bis zum ersten halben Lebensjahr. Umso wichtiger ist die Bereitschaft der Eltern für Früherkennungsuntersuchungen und rechtzeitige Therapiemaßnahmen.